Chiara PIELER / 27. Feber 2025
© DALL-E generiert
Online-Apotheken ermöglichen die Bestellung von rezeptfreien Medikamenten über das Internet und sind eine Alternative zum Einkauf in stationären Apotheken.
Wie sich der Apothekenmarkt verändert
Der Wettbewerb zwischen stationären Apotheken und Online-Anbietern nimmt zu. Während Versandhändler mit bequemer Lieferung und Preisnachlässen werben, setzen stationäre Apotheken auf persönliche Beratung und maßgeschneiderte Arzneimittelanfertigungen. „Wir haben Akademiker in den Apotheken stehen, zahlen Miete, leisten Nachtdienste – all das bieten Versandhändler nicht“, erklärt Gerhard Kobinger. Als Pharmazeut und Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer beschäftigt er sich täglich mit diesen Themen.
Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland
In Österreich ist der Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten verboten – es dürfen lediglich rezeptfreie Produkte online erworben werden. „Das ist wichtig, um eine qualifizierte Beratung sicherzustellen – vor allem hinsichtlich der Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln“, so Kobinger. Dennoch hätte er Bedenken, wenn Österreich dem deutschen Beispiel folgen würde. In Deutschland können nämlich auch rezeptpflichtige Medikamente online bestellt werden. Prominente Persönlichkeiten wie Günther Jauch bewerben diesen Service, was seine Akzeptanz in der Bevölkerung steigert.
Aktuell plant auch die Drogeriekette dm in Deutschland, rezeptfreie, aber apothekenpflichtige Medikamente über einen eigenen Online-Shop anzubieten.
Wirtschaftliche Herausforderungen stationärer Apotheken
Der Großteil des Umsatzes stationärer Apotheken kommt aus Kassenabrechnungen – also Medikamenten, die von den Krankenkassen erstattet werden. Die Apotheken erhalten hierfür jedoch nur eine geringe Handelsspanne von 11,9 Prozent. Gleichzeitig machen die Personalkosten 14 Prozent und die Betriebskosten weitere 8 Prozent an Ausgaben aus. Diese Differenz gleichen Apotheken durch den Verkauf von rezeptfreien Medikamenten und weiteren Produkten aus. „Wenn jedoch ein relevanter Teil der Kunden zu Online-Anbietern abwandert, geraten stationäre Apotheken in wirtschaftliche Schwierigkeiten“, betont Kobinger.

Dr. Mag. pharm. Gerhard Kobinger
Dr. Mag. pharm. Gerhard Kobinger ist Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer und engagiert sich für die Stärkung stationärer Apotheken.
Die Hemmschwelle beim Kauf sensibler Produkte
Ein Faktor, der den Online-Kauf – neben der bequemen Zustellung nach Hause – begünstigt, ist die Hemmschwelle beim Erwerb bestimmter Produkte. Medikamente, die beim Kauf als peinlich empfunden werden – etwa Pilzcremes, Intimhygieneprodukte oder auch Schwangerschaftstests – werden häufig lieber online bestellt, anstatt persönlich in einer Apotheke gekauft. „Viele Menschen scheuen sich davor, persönlich nach bestimmten Produkten zu fragen. Online geht das natürlich diskreter“, erklärt Kobinger. Das ist ein Vorteil der Versandapotheken, aber auch eine Herausforderung für stationäre Apotheken.
Beratungsdiebstahl als Phänomen
Einige Kund:innen nutzen die Beratung in Apotheken und entscheiden sich anschließend für eine Online-Bestellung. Diese Praxis, oft als „Beratungsdiebstahl“ bezeichnet, führt dazu, dass Apotheken zwar ihre Beratungsleistung erbringen, aber keinen Umsatz generieren. „Viele kommen zu uns, lassen sich 15 Minuten beraten, fotografieren die Produkte ab und bestellen dann bei einer Versandapotheke“, kritisiert Kobinger. Dabei geht es dem Pharmazeuten nicht nur um entgangene Einnahmen, sondern auch um die Sicherheit der Patienten, denn „Wechselwirkungen oder individuelle Dosierungen können bei reinen Online-Bestellungen oft nicht berücksichtigt werden.“ Gleichzeitig profitieren Kund:innen von der großen Produktauswahl und häufig günstigeren Preisen im Online-Handel.
Digitale Angebote als Antwort
Viele stationäre Apotheken setzen bereits auf digitale Lösungen. In Österreich bieten rund 300 Apotheken Online-Bestellungen mit Click & Collect oder Lieferung an. Diese Angebote sind eine Antwort auf das geänderte Kaufverhalten der Kunden. „Das Online-Angebot der stationären Apotheken wird aber kaum angenommen“, berichtet der Pharmazeut. Er selbst bietet in seiner Grazer Apotheke seit zwei Jahren die Möglichkeit an, auch online bestellen zu können. „Aber mit den Preisen der großen Versandhändler kann ich nicht mithalten, deshalb bleibt die Nachfrage sehr gering.“
Datenschutz und Sicherheitsbedenken
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Online-Kauf von Medikamenten ist der Schutz persönlicher Gesundheitsdaten, die zu den sensibelsten Informationen gehören. „Wenn Kund:innen Medikamente online bestellen, hinterlassen sie digitale Spuren – von der Bestellung bis zur Bezahlung. Wer garantiert, dass diese Daten sicher verwahrt und nicht für Werbezwecke oder Analysen genutzt werden?“, gibt Kobinger zu bedenken. Während Apotheken einer strengen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ist bei internationalen Versandapotheken oft unklar, wie umfassend der Datenschutz tatsächlich umgesetzt wird. prima! hat ausländische Versandapotheken, die Österreich beliefern, über Monate hinweg kontaktiert, um eine Stellungnahme zu den genannten Kritikpunkten gebeten. Eine Antwort blieb jedoch aus.
Letztendlich liegt die Entscheidung bei den Konsument:innen. „Arzneimittel sind keine Konsumgüter, sondern hochwirksame Substanzen, die eine fachkundige Beratung benötigen“, macht Kobinger deutlich. „‚Geiz ist geil‘ mag in vielen Bereichen funktionieren – im Gesundheitssystem jedoch nicht.“
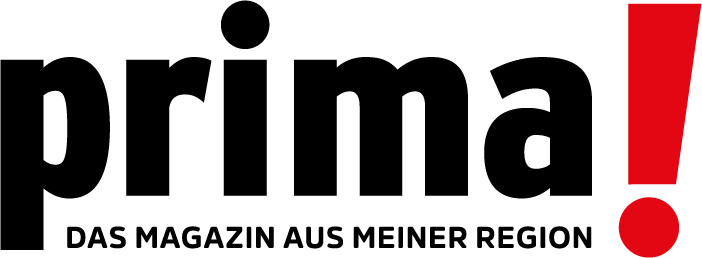
Schreibe einen Kommentar